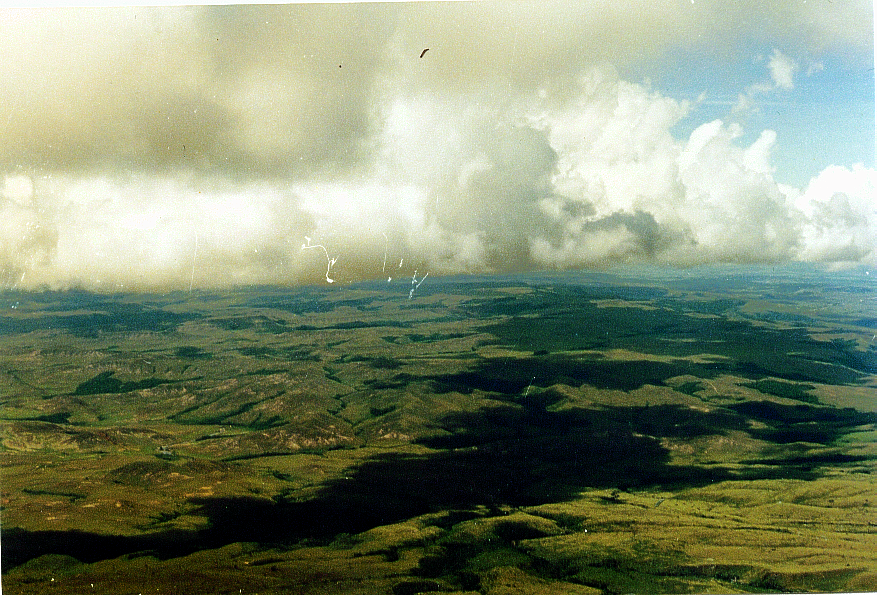Das süße schwarze Gift - Caudillos und soziale Befreiung in Venezuela
Venezuelas süßes schwarzes Gift – Caudillos und soziale Befreiung nach Chávez
„Es gibt die Neue Linke in Lateinamerika. Sie besteht aber nicht aus Evo Morales und Hugo Chávez, sondern aus den Menschen, die in sozialen Bewegungen für eine gerechtere Welt kämpfen.“ (der argentinische Aktivist Roberto Marino)
Der Caudillo ist ein militärischer Führer. Die von ihm ausgeübte Herrschaft, die Caudillaje als Wesenszug lateinamerikanischer Gesellschaften hielt sich in Venezuela länger als in anderen Ländern. Nicht Institutionen, sondern die „harte Hand“ einer Persönlichkeit und seiner Getreuen beherrschen die politische Situation, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisation.
Bestimmte Gesellschaften begünstigen solche autoritären Führer von sozialen Bewegungen: Eine mangelhaft produzierende Wirtschaft, für deren Mängel konkrete Gruppen und Cliquen verantwortlich scheinen, dazu unzureichende Bildung und eine damit einhergehende Begeisterung für starke Führer mit einfachen Lösungen - der Populismus.
Ein Vermächtnis des in Venezuela allgegenwärtigen Christentums ist die millenarische Vorstellung, die Geschichte hätte ein Ziel, und das „Gute“ könnte durch Vernichtung des „Bösen“ erreicht werden. Die linke Lesart, dass die Kirche die Ideologie lieferte, um die Ausplünderung der Ressourcen und den Völkermord an den Indigenen zu segnen, ist nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Das instrumentelle Verhältnis der Kolonialherren zum katholischen Glauben überdeckt nämlich, dass christliche Apokalyptik auch Befreiungsbewegungen in Venezuela auszeichnet. Eine Folge ist eine religiös aufgeladene Wahrnehmung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Die Verflechtung von Kirche und Militär zeigt sich daran, dass Offizier nur werden kann, wer kirchlich geheiratet hat. General Raúl Isaiás Baduel, der den rechten Putsch 2002 niederschlug, sagt über sich: „Ich bin überzeugter Katholik und dazu stehe ich. Außerdem: Als Fallschirmjäger bedarf man eines großen Vertrauens in eine höhere Macht.“
Klassenkampf war in Venezuela nicht Metapher für ein sozioökonomisches Verhältnis, sondern blutiger Krieg. Orlando Araujo sah 1969 zur Gewalt der Ausgebeuteten keine Alternative: „Sie fügen ihre Gebeine und den Strom ihres Blutes zu den Gebeinen und dem Blut der für die Befreiung anderer Länder Gestorbenen in einer Welt, in der die Unterdrückten in einem harten Kampf gelernt haben und noch lernen werden, dass die Gewalt der Ausbeuter nur durch die Gewalt der Unterdrückten überwunden werden kann.“ Venezuelas Geschichte ist eine Geschichte des Terrors und der Ausbeutung. Vom Völkermord an den Indios über die Versklavung der Schwarzen, von der de facto Leibeigenschaft auf den Plantagen, von den Konzentrationslagern der Militärdiktatur bis zur Unterdrückung sozialen Widerstands durch das US-hörige Parteienkartell zieht sich ein Blutstrom durch die Geschichte des von der Natur gesegneten Landes.
Caudillos waren Führer der Milizen in den Kämpfen um die politische Unabhängigkeit und den späteren Bürgerkriegen. Sie kamen oft selbst aus dem sozialen Elend und gelangten durch militärische Siege an die Macht. Páez, der Präsident des unabhängigen Venezuelas seit 1830, gilt als eine Art an die Macht gekommener Robin Hood. José Tadeo Monagas, Staatsoberhaupt nach 1847, Cipriano Castro, der das Land von 1899-1908 führte und Ezequiel Zamora, General und Bauernführer, entsprachen alle dem Caudillo und sind Nationalhelden. Chávez stellte sich bewusst in die Tradition von Zamora.
Der Fluch des schwarzen Goldes
Ein Schlüssel zur sozialen Geschichte Venezuelas ist der Erdölreichtum; das Land verfügt über die fünftgrößten Erdölvorkommen der Welt. Eduardo Galeano schrieb 1971: „Fast die Hälfte der Gewinne, die das nordamerikanische Kapital Lateinamerika entzieht, stammt aus Venezuela. Dies ist eins der reichsten Länder der Erde und gleichzeitig eines der ärmsten und von den Auswüchsen der Gewalt meist heimgesuchten. Es weist das höchste Pro-Kopf-Einkommen Lateinamerikas auf; im Verhältnis zur Bevölkerungszahl trinkt keine Nation der Welt so viel schottischen Whisky. Rings um Caracas betrachten Ausgestoßene von ihren aus Abfällen errichteten Hütten die fremde Verschwendung. Etwa die Hälfte der Kinder und Jugendlichen bleibt den Schulen fern.“ Die einheimischen Kapitaleigner investierten nicht im Land; die meisten Arbeiter waren für den Reichtum der Ölkaiser überflüssig – eine frühe Form der Prekarisierten: Die Oberschicht band sich an die USA und bezahlte amerikanische Konsumgüter mit dem unverhofften Geld aus dem Öl. Ein Motiv der Bourgeoisie Europas und der USA lag im Schutz der eigenen Märkte; auch aus diesem Grund verwandelten sich feudale Territorien in Nationalstaaten; die „Bourgeoisie“ in Venezuela jedoch bestand aus Verteilercliquen, die die nationalen Reichtümer an die fortgeschrittenen Kapitalstaaten weiterleiteten.
Galeano sah in den Oligarchien, die den Reichtum des Landes verprassten und dem Wirtschaftssystem, das die Bevölkerung von dem Erlös der Bodenschätze fernhielt, die Tragik Venezuelas. So hätte Venezuela den Wohlstand jedes Staatsbürgers verzehnfachen können. Mit dem Erdöl hatte sich das Nationalbudget um das hundertfache erhöht: „Kein Land hat dem Kapitalismus so viel in so kurzer Zeit eingebracht.“
Oligarchie, die Herrschaft kleiner Gruppen, die in Venezuela den Reichtum aus dem Öl unter sich aufteilten, steht in Verbindung zum Klientelismus. Dieses System organisiert Ungleichheit mit personalen Bindungen, erpresst Widersacher und belohnt Zuarbeiter: Der Patron erhält für den Schutz seiner Klientel Gegenleistung in Form von Arbeit und Gütern sowie Loyalität, also Treue.
Für Venezuela ist der spezifische Charakter mafiöser Führerfiguren wichtig; „Mafia“ ist kein durch Verfassungsrecht definiertes Staatswesen: Das persönliche Charisma, die Überzeugungskraft verbindet sich mit der direkten Umsetzung von Interessen durch wörtlich zu nehmendes Faustrecht – bis hin zum Mord. Der Strafenkatalog von Gesellschaften, die nach Mafiaprinzipien organisiert sind, ist rigide. Die Gewalt geht einher mit der Bewunderung der Patrone und Caudillos durch ihre Anhänger. Außerhalb der verbindlichen Ebene des Rechtstaats nehmen sie die Rolle des Patriarchen ein und müssen diese immer wieder von neuem beweisen. Die Macht eines Patrons steigt nicht nur durch die von ihm ausgeübte Gewalt, sondern auch durch die Menge seiner Gefolgsleute. Die Nähe dieser Gefolgsleute zu den bestimmenden Bossen, zum inner circle bestimmt ihren Zugang zu Ressourcen.
Für Gesellschaften, deren Struktur auf Klientelbeziehungen basiert, ist Korruption als Bestechlichkeit innerhalb stabiler staatlicher Behörden Augenwischerei. Der Klientelismus ist kein „Dorn im Fleisch“ einer stabilen Verwaltung, sondern ein eigenes Organisationssystem, das parallel zum oder innerhalb des formalen Regierungsmodells existiert und sich vor oder mit ihm entwickelte. Die empirischen Daten für Venezuela sprechen eine klare Sprache: 2009 nahm der Ölstaat laut Transparency International den Spitzenplatz der korruptesten Länder Lateinamerikas ein, übertrumpft nur von der sozialen Hölle in Haiti.
Günstlingswirtschaft unter Chávez
Hugo Chávez polarisierte. Die Parteivertreter des Neoliberalismus weltweit geißelten Chávez als Diktator. Fidel Castro, Parteilinke, aber auch Antiautoritäre wie Noam Chomsky, Politiker der ehemals blockfreien Staaten wie Indien und Gestalten wie Irans Ahmadinedschad feierten den Präsidenten. Unter dem Stichwort „Venezuela is not for Sale“ galt er als der, der die Übergriffe von USA und Weltbank in Schach hielt und den „Sozialismus des 21. Jahrhundert“ aufbaute.
Bewunderung einerseits und Verteufelung andererseits verzerren den Blick auf die wirklichen Probleme: Klientelismus und Patronage sind nämlich in Venezuela tief verankert. Der Bolivarianismus versteht sich als Alternativmodell zur Ideologie des freien Marktes, die seit Margaret Thatcher und Ronald Reagan politische Hegemonie erlangte. Dies führte zum Machtausbau weniger Großkonzerne, die die Politik in den USA und der Welthandelsorganisation beeinflussten, und, laut Noam Chomsky, die Demokratie zerstören. Ist der Bolivarianismus aber auch ein Gegenmodell zum Prinzip der Patronage? Immerhin entzündete sich der Aufruhr gegen das Parteienkartell, weil es eine neoliberale Politik gerade gegen den Klientelismus durchsetzte, das heißt, Subventionen für Güter und im Gesundheitswesen kürzte. Die Milderung der sozialen Härten war zuvor fester Bestandteil der Patronage gewesen.
Der Chávez-Anhänger Santiago Rodrigues beschreibt die heutige Funktionärspatronage: „Unverblümt wird die Weisung ausgegeben, dass, wenn ein Vertreter der PSUV teilnimmt, ein Vertreter der Oppositionsparteien nicht anwesend sein darf. Niemand, der nicht zur PSUV gehört, darf teilnehmen. Durch diese Aneignung des öffentlichen Raumes wird die Macht des Volkes abgewürgt.“ Die Verwalter des Klientelismus des alten Parteienkartells, das Chávez angeblich bekämpfte, wechselten demnach zur bolivarischen Partei und führen den Klientelismus fort. Der Venezuela-Experte Darion Azzellini schätzt die Lage ähnlich ein: „Und unter vielen Politikern aus den traditionellen linken Parteien oder solchen, die auf den Chávez-Zug aufgesprungen sind, bleiben paternalistische (…) Praktiken und personalisierte Politikmuster weit verbreitet.“ Das Patronagesystem blüht demnach weiterhin unter chávistischen Vorzeichen.
Rodrigues kritisiert: „Was wir jetzt haben, ist der Sozialismus eines Gouverneurs, der anordnet, dass alle Polizeifahrzeuge die Aufschrift „Sozialistische Polizei“ tragen müssen. Keine der fragwürdigen Methoden der Polizei wurde (…) verändert, keine der repressiven Strukturen, keine der autoritären Entscheidungsmechanismen revidiert.“ Paternalismus vor Ort wirkt demnach weiter, diese Bevormundung steht der im Bolivarianismus postulierten Partizipation der Menschen entgegen.
Das Weiterwirken autoritärer Strukturen in Verwaltung und Polizei ist ein ernstes Problem. Klientelismus und Patronage wirkten auch in der Ära Chávez in schärfster Form weiter, nämlich in der Verschmelzung von Mafia und Regierung. Walid Makled, der „König der Paten“, einer der größten Drogenschmuggler der Welt beschuldigte Militärs und Geheimdienstchefs, im Drogengeschäft involviert zu sein: „Wenn ich dafür in Haft gehe, dann müssen deswegen auch der Direktor des (militärischen Geheimdienstes) DIM, General Hugo Carvajal, der Chef der (ehemaligen politischen Polizei) DISIP, General Rangel Silva, Armeechef Luis Motta und General Néstor Reveról, Leiter der (Anti-Drogenbehörde) ONA, inhaftiert werden.“ Chávez bezeichnete diese Aussagen als Lügen eines Banditen. Der Hinweis auf Verbindungen zwischen organisierter Kriminalität und Staatsapparat erwies sich aber als berechtigt: „Der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Carabobo, Felipe Acosta Carlez, verlor unter dem Vorwurf der Zusammenarbeit mit Makleds Drogenkartell (…) die Unterstützung des Regierungslagers.“ Chávez Absicht, solche Verfechtungen zwischen Kriminalität und Staatsapparat zu bekämpfen, war zwar glaubwürdig, aber die „bolivarianische Revolution“ bewegt sich als Mittler zwischen Basisbewegung und Regierung auf Messers Schneide - in einem Garten Eden der organisierten Schwerstkriminalität.
Eine Verwaltung der von den lokalen Volksinitiativen eingebrachten Projektideen ist notwendig, um Wohnungs- oder Straßenbau umzusetzen; eine Polizei ist auch vor Ort im Viertel notwendig – als Wunsch steht hier die Exekutive des Rechtsstaates gegen das Faustrecht der Mafia. Verwaltung, Polizei und Justiz müssten aber durch die Komitees und Volksinitiativen kontrolliert sein. Erst ein rechtsstaatlicher Rahmen ermöglicht Freiräume für die autonome Organisation vor Ort.
Ausblick