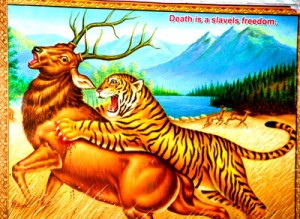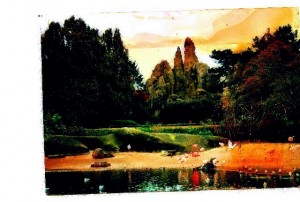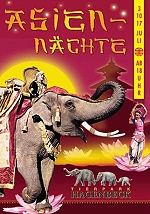Die Wirklichkeitsbegriffe eines deutschen Geisteswissenschaftlers sind andere als die eines Rastamanns aus Sansibar, Tansania oder Uganda.
Die Rastafarireligion zeigt neben dem Kampf der entrechteten Schwarzen als emanzipatorisches Element auch deutlich autoritäre Züge. Diese Ambivalenz wird hier beschrieben. Zudem wurde in einigen Gesprächen in Ostafrika die individuelle Verschiedenheit von Rastafari-Mentalitäten deutlich. Diese als europäischer Reisender und Historiker zu kennzeichnen, ist schwierig, da die Wirklichkeitsbegriffe eines deutschen Geisteswissenschaftlers andere sind als die eines Rastamanns aus Sansibar, Tansania oder Uganda. So kann es hier nur um eine Annäherung gehen.
Zur Geschichte: In den 1840ern waren sogenannte Native Baptists in Jamaika zur eigenständigen Religionsgemeinschaft neben dem weißen Christentum geworden. Sie vermischten christliche Vorstellungen mit afrikanischer Spiritualität, indem sie etwa die Inspiration durch den Heiligen Geist (analog zur animistischen Geistesbesessenheit) zum Bestandteil ihrer Gottesdienste machten und Johannes den Täufer als den Meister des Rituals über Jesus stellten (nach afrikanischen Vorstellungen sind Flüsse Heim der Schutzgeister). Im jamaikanischen Sklavenaufstand von 1831/32 diente die Bibel als Beleg für die Unchristlichkeit der Sklaverei. Das synkretistische Element dieses schwarzen Baptismus zeigte sich in der afro-jamaikanischen Interpretation, daß Sünde kein Übergriff gegen Gott, sondern Schadenszauber von Menschen gegen menschliche Gesellschaft, somit der Kampf gegen die Sünde (Ausbeutung, Manipulation, Machtmißbrauch, Versklavung) weltlich und nicht überirdisch sei.
Macht und Schadenszauber
Die Vorstellung eines Schadenszaubersdurch Schwarzmagier, im Swahili mwombe genannt, findet sich in afrikanischen Kulturen bis heute. Im Unterschied zur kirchlich ideologisierten europäischen Hexenverfolgung der frühen Neuzeit bezieht sich diese Definition jedoch nicht primär auf Angehörige unterpriveligierter und marginalisierter Gruppen, sondern vor allem auf die Ausübung von Macht mittels Terror und Manipulation durch undurchschaubare herrschende Institutionen und Individuen. In Haiti wurden noch im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts die tontons macoutes, die Angehörigen von Duvaliers Geheimpolizei als Schadenszauberer angesehen.
Die afrikanische Bibel
Die Interpretation der Bibel, welche in Jamaika das einzig verfügbare Buch im 19. Jahrhundert war, führte zur Durchbrechung des weißen Realitätsgefüges und ermöglichte eine Kennzeichnung der afrikanischen Ursprünge der entwurzelten Sklaven.[1] Da die europäischen Sklavenhalter die Legitimation ihrer Herrschaft wie auch die jahrhundertelangen Deportationen von Afrikanern, den Geno- und Ethnozid in Amerika und die Kolonialisierung und Entrechtung der nichteuropäischen Welt mit der Notwendigkeit zur Bekehrung der “Ungläubigen” zum Christentum legitimiert hatten, schuf die Eigendefinition der Entrechteten über die Bibel die Möglichkeit mittels des Instrumentariums der Ausbeuter die eigene Entwurzelung aufzubrechen und Gegenmacht zur “weißen” Geschichtsinterpretation aufzubauen. Dabei kann, abgesehen von einem strikt säkularisierten Teil der Rastafaribewegung, das spirituelle System der Rastafari, welches wie auch andere schwarze Glaubensrichtungen des 19. und 20. Jahrhunderts letztlich auf dem Befreiungssynkretismus der amerikanisch-karibischen Schwarzenbewegungen des 19. Jahrhunderts basierte, keinesfalls als instrumentell angesehen werden.
Eine selektive Übernahme christlicher Lehren verbunden mit eigenen Interessen nach Befreiung von rassistischer Herrschaft durch Afro-Jamaikaner bot den Vorzug der Zustimmung und Duldung durch die weißen Missionare. Dabei wurde jedoch das weiße Wirklichkeitsverständnis abgelehnt und durch den Äthiopianismus ersetzt, welcher wiederum biblisch begründet werden konnte. Kern des jamaikanischen Bibelverständnisses wurde der Psalm 68, 32: “(…) Äthiopien wird seine Hände zu Gott ausstrecken (…)”. Diese Zeile wurde in Abessinien bereits im 16. Jahrhundert als Hinweis darauf gesehen, daß die Urchristen aus Äthiopien kamen. Im Äthiopianismus des 19. Jahrhunderts veränderte sich der Gegenmythos zur “weißen” Schöpfungsgeschichte als “Black Messianism” zu einem Instrument schwarzen Widerstandes, der die Afrikaner, symbolisiert durch die Pharaonen Altägyptens, zu den Trägern von Kultur und Spiritualität in der Weltgeschichte erklärte. Dabei verband Edward W. Blyden (1822-1912) als einflußreicher schwarzer Theoretiker der Karibik jüdische Glaubens- und zionistische Elemente mit dem afrikanisierten Bezug auf die Bedeutung Äthiopiens im Alten Testament. Politische Bedeutung erhielt der Äthiopianismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch die Ereignisse in Afrika selbst. 1896 hatte der äthiopische Kaiser Menelik II. bei Adua die italienischen Truppen geschlagen. Äthiopien (Abessinien) blieb das einzige Land in Afrika, das nicht unter europäischer Kolonialherrschaft stand.
Fürsten der Welt
Der Begriff Rastafari leitet sich ab vom Fürsten (Ras) Tafari, der 1892 zum König (negus) von Äthiopien gekrönt wurde und 1930 im Rahmen der Kaiserkrönung den Namen Haile Selassie (Kraft der Dreifaltigkeit) annahm. 1941 gelang es diesem mit Unterstützung Englands, Äthiopien von den italienischen Okkupatoren zurückzuerobern. Dies machte ihn bei vielen Schwarzen in Afrika und in der schwarzen Diaspora[2] zum Messias. Für die Entwicklung der Rastafaribewegung ist entscheidend, daß er einen Gottescharakter im Diesseits bekam.[3] Auch wenn Haile Selassie in Äthiopien das orthodoxe Christentum förderte, wäre es verkürzt, die Rastafaribewegung als christliche Kirche oder Sekte anzusehen. Insbesondere in der Karibik, wo die Rastas ihren Ursprung haben, kommen diese zwar aus protestantischen und katholischen Glaubenszusammenhängen, betrachten sich selbst aber nicht (mehr) als Christen. Die Basis ihrer religiösen Definition ist vielmehr ein Synkretismus aus afrikanischer, jüdischer und christlicher Tradition. Dabei ist als christliches Element die Erlösungsvorstellung tragender Pfeiler der Weltanschauung. Im Unterschied zu den meisten “weißen” anglo-amerikanischen Bibelinterpretationen greift diese jedoch die Erfahrung von Unterdrückung und Widerstand der ehemaligen schwarzen Sklaven auf als Verheißung eines menschenwürdigen Lebens in dieser Welt, womit vor allem die Erlösung von Sklaverei und dem Leben in der Diaspora, verbunden mit deHerkunft, Mystifizierung und Spiritualisierung politischer Forderungen, Militarisierung, Ablehnung von “Rassenmischungen”), andererseits muß die Verwendung dieser Topoi auch in Zusammenhang mit der real erfahrenen Diskriminierung und den ideologischen Formationen von rassistischer Herrschaft des weißen Amerika gesehen werden.
Schwarzer Rassismus?
Dieser Aspekt ist besonders sensibel zu betrachten, da die jahrhundelange Hierarchisierung von Schwarzen untereinander in den USA und der Karibik gezielt über die Hautfarbe erfolgte und Farbige real im Durchschnitt über einen höheren sozialen Status verfügten als diejenigen mit tiefschwarzer Hautfarbe. Auch heute noch ist die Sozialstruktur in Jamaika pyramidal, mit einer winzigen weißen Oberschicht, einer farbigen Mittelschicht und einer schwarzen Unterschicht.[5] Selbstredend war dies keine Folge ihrer Charaktereigenschaften, sondern Effekt rassistischer Integration und Absonderung der Sklavenhalter. Diese Herrschaftsprinzipien bieten einen idealen Nährboden für einen mythischen umgekehrten Rassismus, welcher auch von den meisten Rastafari abgelehnt wird.
So nachvollziehbar das Bedürfnis Garveys und seiner Anhänger aus der urbanen schwarzen Unterschicht nach einer Umkehrung der auf “Negros” projizierten rassistischen Stereotypen ins Gegenteil im Sinne eines “schwarzen Rassenstolzes” auch ist und Befreiungsnationalismus unterdrückter Minderheiten nicht mit dem Nationalismus imperialistischer Herrschaftseliten gleichgesetzt werden kann, so darf die Radikalität von Garvey auch keinesfalls als linksgerichtet bewertet werden. Die soziale Revolution und die soziale Frage tauchen als solches bei ihm nicht auf. Staatliche Hierarchien werden nicht abgelehnt, sondern afrikanisiert. Ziel der Afrikaner soll die Rückkehr nach Afrika sein. Es ließe sich argumentieren, daß Garvey sich lediglich im Geiste seiner Zeit über gängige Begrifflichlichkeiten definierte. Das schließt allerdings die Berücksichtigung ein, daß die 20er Jahre die aufkeimende Epoche des Faschismus war und Mussolini oder Hitler ähnliche Argumentationsmuster wie Garvey verwandten. Analoge Glaubensbekenntnisse (Hitler als “Messias der arischen Rasse”) lassen sich auch in den europäischen völkisch-faschistischen und nationalsozialistischen Gesellschaftsentwürfen finden. Andererseits war Garvey schwarzer Jamaikaner und kein Europäer, was bei analogen Mustern und Begriffen nicht unbedingt auf eine Gleichartigkeit der Herrschaftsvorstellungen schließen lassen muß.
Haile Selassie - der Pharao von Äthiopien
Die Vorstellung des Gottkönigs Ras Tafari stammt nicht von Garvey, der am pragmatischen Ziel einer Rückkehr nach Afrika arbeitete. Nach der Königstitulatur Haile Selassies wurde diese Lehre von schwarzen Predigern (Garvey war vor allem politischer Aktivist) wie Howell, Hibbert und Dunkley vertreten, die den König Äthiopiens mit dem endzeitlichen Christus gleichsetzten. Von ihnen wurde die Weltregierung der Schwarzen verkündet, die Schwarzen galten als Reinkarnationen der alten Israeliten und sie würden sich an den Weißen rächen. Haile Selassie galt hier als materieller lebendiger Gott und Kaiser der Welt, wobei dieses Gottestum durchaus militärisch und kriegerisch bestimmt war. Die göttliche Gegenwart konnte jeder Mensch prinzipiell erreichen. Besagter Howell ist der eigentliche Gründungsvater der Rastafari. Seine Anhänger ließen sich die ersten Furchtlocken (Dreadlocks) wachsen, inspiriert von Lev 21,5, wonach Priester ihr Haar nicht schneiden sollen, möglicherweise auch von Bildern der Massai und Somali.
Howell verband außerdem die Rastafarikultur mit der aus den “Native Baptists” hervorgegangenen Black Power Bewegung. Hier mischten sich religiöser schwarzer Nationalismus und afro-jamaikanische Volksreligiösität mit dem Widerstand der landlosen schwarzen Bauern und Bäuerinnen gegen die Pflanzeroligarchie, wobei letzterer auf einen sozialrevolutionären Charakter hindeutet. Der italienische Angriff auf Äthiopien 1935 stärkte die junge Rastafaribewegung. L.F.C. Mantle von der “Ethiopian World Federation” stellte die Theorie auf, daß die Wissenschaften in Äthiopien entstanden seien. Von enormer Bedeutung für das Selbstverständnis der Rastafari ist seine These, daß die ursprünglichen (”echten” oder “wahren”) Juden in Äthiopien leben würden und schwarz wären, wobei die Anglo-Juden Resultat späterer Vermischung seien. Auch diese These bleibt im Aufbau eines National-(Afrika-)Mythos einer potentiell rassistischen Argumentation verhaftet. Haile Selassie fungierte als Symbol für einen kompromißlosen Krieg der “schwarzen Rasse” gegen Kolonialismus und Unterdrückung, der die gesamte bestehende Welt transformieren würde.
Dabei lag die Hoffnung dieses Kampfes eben nicht in einem Klassenkampf mit dem Ziel der Zerstörung von ausbeuterischen Herrschaftsstrukturen an sich, sondern in der Glorifizierung absoluter Herrschaft eines irdischen Gottes, wenn er denn nur der “eigenen Rasse” entsprang. Ziel ist, bei allen Teilen der Rastabewegung, keinesfalls die Aufhebung von Herrschaft, sondern die Rückkehr nach Afrika und das Leben unter afrikanischer Herrschaft. Einschränkend muß dazu gesagt werden, daß diese Vergöttlichung in der Rastafarikultur auch beinhaltete, der eigenen Existenz als Proletarier und ehemaliger Sklave zumindest mystisch in eine andere Seinsordnung entfliehen zu können.
Diese “Einheit mit Gott” kann somit auch dem Wissen um die Möglichkeit einer sozialen Veränderung dienen, bzw. dem Aufbau von konkreten Utopien, in denen Kolonialismus und Sklaverei nicht als Gottesgesetz dienen. Diese “feinstoffliche” Zusammengehörigkeit war gerade für die Schwarzen in der Sklaverei, die aus verschiedensten Ethnien stammten und unterschiedlichste Sprachen hatten, extrem wichtig. Das Bindeglied stellte die Religion her. In diesem Zusammenhang hat der Mythos der afrikanischen Schöpfung als Hoffnung der Entrechteten auf ein besseres Leben durchaus emanzipatorischen Charakter. Zudem beinhaltet die religiöse Identifikation die Möglichkeit der Identifikation untereinander, die Gemeinschaftlichkeit einer “schwarzen Familie”.
Die Religion: Nur ein kleiner Teil der Rastafarikultur ist religiös, andere Gruppierungen erklären ihren Rastafarianismus aus der Geschichte der Sklaverei. Die Religion der Rasta-Brüder unterscheidet sich elementar vom europäischen Christentum. Zwar hatten auch die Rastas als Diener und Sklaven von Puritanern die Bibel als Basis ihres Glaubensbekenntnisses, doch wird diese als von den Sklavenhaltern manipuliert angesehen, weshalb nur bestimmte Teile, vor allem Moses und Jesaja, von ihnen akzeptiert werden. Gott ist in Haile Selassie Mensch geworden und lebt in dieser Welt und in diesem Leben, zu dem es keine Alternative gibt, da dies die beste aller Welten sei. So besteht Leben aus Reinkarnationen, was stark an die Ahnenkulte der Yoruba in Westafrika erinnert, die einen Großteil der Sklavenbevölkerung Jamaikas stellten. Zion sei gleichbedeutend mit Äthiopien und von Gott als auserwählt betrachtet worden, nachdem Israel Babylon verfiel.
Lions of Zion

Es ist unmöglich, die Geschichte der afrikanischen Deportation von der biblischen Tradition der Rastafari zu trennen, da Literatur, Geschichte und Religion verschmelzen.
Symbol der Rastafari ist der Löwe. Die Dreadlocks einiger von ihnen sollen an dessen Mähne erinnern, gleichzeitig symbolisiert er Afrika. Das Löwenemblem zeichnet das äthiopische Kaisertum aus. Zugleich ist das Lamm “Symbol des Königs der Könige”, das von den auserwählten Löwenmännern, den Rastafari geschützt wird. Durch die Selbstdefinition über die Bibel gelang es den Rastafari, sich aus der Fremddefinition als Sklaven zu befreien und ihr Leid in dieser Welt als Babylon, als Leben im Exil zu erklären. Dabei ist es unmöglich, die Geschichte der afrikanischen Deportation und die Kolonialherrschaft von der biblischen Tradition der Rastafari zu trennen, da in ihren eigenen Beschreibungen Literatur, Geschichte und Religion miteinander verschmelzen. Emanzipatorisch ist daran, daß der afrikanische Gott auf eine Veränderung der Verhältnisse in dieser Welt geradezu drängt. Der Papst ist für Rastafari der Teufel, wohingegen JAH (Gott) mit dem Kaiser von Äthiopien verschmilzt. Auch wenn die Rastafari mit den Juden den Bezug auf Zion, das Alte Testament und die Diaspora teilen, hat der mythische Bezug auf Äthiopien niemals zu einem konkreten Nationalismus geführt, nachdem Marcus Garvey mit seiner Rückbringung scheiterte. Heute wird als Heimat der Rastafari eher Jamaika als Afrika angesehen. Durch die Betonung einer individuellen Gotteserfahrung, eng verbunden mit Marihuanagenuß, bleibt der Rastafarianismus im Vergleich zum klassischen Christentum undogmatisch und entspricht eher afrikanischen Traditionen. Zudem fehlt den Rasta-Brüdern in ihrer auf das Diesseits ausgerichteten Religion die Transzendenz, weshalb sie sich selbst eher als Wissende denn als Gläubige betrachten. Als Bezugssystem ehemaliger Sklaven ist Rasta stark auf die Handhabung der (materiellen) Realität bezogen. Ras bedeutet Fürst. Da aber jeder Rastabruder vor seinen Namen das Prefix Ras stellt, ist auch jeder von ihnen ein Fürst in dieser Welt. Religiöse Rastafari betrachten sich, verbunden durch die göttliche Einheit, als eine große Familie: sie sollen sich untereinander helfen, gegenseitig unterstützen, ihre materiellen Güter miteinander teilen.
Moderne Rastafari
Die modernen Rastafari vertreten dabei nicht den Ausgrenzungsmechanismus von Marcus Garvey, sondern auch Weiße haben die Möglichkeit zur Erlösung, wenn sie Babylon abschwören. Sie sind tiefreligiös und viele verbringen den Großteil ihrer Zeit mit dem Bibelstudium. Abgesehen vom Kraut der Bibel, dem heiligen ganja (Marihuana), dürfen sie keine Drogen zu sich nehmen, insbesondere keinen Alkohol, kein Nikotin und kein ungesundes Essen, wozu auch Konservenbüchsen zählen. Rastafari dürfen nicht stehlen und kein Lebewesen ohne Grund töten.
Rastafari in Tansania und Uganda
Im folgenden Teil berichte ich von persönlichen Erfahrungen mit Rastafari in Ostafrika. Nicht mehr Afrika, wo sie selbst leben, erscheint in ihrer Vorstellung als “gelobtes Land” (auch wenn sie die Verehrung von Haile Selassie und Äthiopien durchaus teilen), sondern sie definieren sich über Jamaika. Es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Ging es in der Entstehung des Rastafarikultes in Jamaika darum, die Rückkehr nach Afrika zu ermöglichen, erfolgt die Selbstverortung ostafrikanischer Rastafari über religiöse und kulturelle Inhalte, als deren Ursprung Jamaika erkannt wird. Sie definieren sich somit nicht mehr primär über den Ort Afrika, wo außer ihnen noch unterschiedlichste andere Glaubens- und Kulturgemeinschaften existieren, sondern über ihre Zugehörigkeit zur Rasta-family. Während die spirituelle Basis der Rastafaribewegung in Jamaika auf westafrikanischen Bezügen basiert, finden hier Synkretismen mit ostafrikanischem Glauben statt.
Zweierlei Äthiopien
Die Identifikation mit Äthiopien ist eine mythologische; das jetzige politische System in Äthiopien spielt bei den Rastafari, die ich kennenlernte, keine Rolle. Im Gegenteil zeigten einige sogar ausgeprägte Sympathie für den eritreischen Befreiungskampf und die Unabhängigkeit Eritreias. In der keineswegs homogenen jamaikanischen Rastafaribewegung stammen die Furchtlocken als äußerliches Element nicht aus West- sondern aus Ostafrika, was deren Popularität in Tansania und Uganda möglicherweise erklärt und sind Kennzeichen des radikalsten Teils der Rastakultur.
Während sich alle Rastas darüber einig sind, daß Schwarze als Folge der Sklaverei in der westlichen Welt entrechtet sind, was entweder säkulär-historisch oder religiös begründet wird, gehen die Lockenträger einen Schritt weiter und definieren sich über eigene mythologisierte “Kriegertugenden” historischer ostafrikanischer Völker. Letzteres wird vom Großteil der jamaikanischen Rastafari abgelehnt, könnte aber ein Hinweis auf die Verbreitung des Rastafarianismus in ostafrikanischen Gesellschaften sein. Die Dreadlocks können als Teil einer Gegenbewegung innerhalb der Rastafarikultur angesehen werden. Viele Rastafarianer tragen einen Kahlkopf und nur wenige äußere Attribute Afrikas, andere gemäßigte Rastafari tragen zwar einen Bart und langes Haar, achten aber darauf, dieses zu pflegen und unter einer Mütze zu tragen.
Eine andere Fraktion trägt die Dreadlocks ungezähmt als Zeichen ihres biblisch interpretierten Fluchs, als Auserwählte in der Diaspora leben und das Kreuz tragen zu müssen. Diese Lockenträger fühlen sich nicht den Normen der (schwarzen) jamaikanischen Gesellschaft verpflichtet, sondern haben ihre eigenen und werden deshalb von gemäßigteren Rastafari abgelehnt, da diese sie der Diskreditierung der Rastafarikultur durch (verbale) Gewalt, ungepflegtes Auftreten und Drogenkonsum bezichtigen. Es gibt hier durchaus Überschneidungen zwischen alttestamentarischer Orthodoxie und (sozial-) revoltierendem Verhalten jugendlicher Schwarzer.
In Tansania hat Rastafarianismus nicht den Charakter einer Kultur, sondern einer Subkultur. Rasta zu sein ist eher als Selbstverortung außerhalb der herrschenden Kulturen zu begreifen, denn als gesamtgesellschaftliche Bewegung - im Gegensatz zu Jamaika, wo die Rastakultur die Lebensverhältnisse der jamaikanischen Gesellschaft widerspiegelt.
Ein Unterschied liegt in Tansania auch darin, daß die Definition über eine family, über die Rückkehr nach Äthiopien, als verbindendes Element der aus unterschiedlichsten afrikanischen ethnischen Zusammenhängen herausgerissenen Schwarzen in der Karibik notwendig war, während sie in Ostafrika nicht solch eine zentrale Bedeutung hat, da hier die kulturellen Strukturen vieler Ethnien sehr festgefügt sind. Rastafarianismus wird somit in Ostafrika nicht im Sinne einer nationalen Identitätsbildung in der Isolation begriffen, sondern als Bezugssystem außerhalb der bestehenden ethnischen Strukturen und sie ergänzend.
Vorherrschende Religionen wie der Islam in Sansibar oder die katholische Kirche in Nordtansania stehen den Rastafari eher ablehnend gegenüber, was für verschiedene Ethnien wie die Massai oder Sukuma ebenfalls gilt. Dies läßt sich allerdings nicht verallgemeinern. Rastafarianismus ist in Tansania und Uganda eine Außenseiterkultur.
Omir, ein RasMuslim: Die Lebensphilosophie Omirs ist ein hervorragendes Beispiel für die Religions- und Kulturmischungen in Stone Town auf der Insel Sansibar. Zur Zeit des sansibarischen Sultanats, das Drehpunkt des arabischen Sklavenhandels über Jahrhunderte und Basis der späteren europäischen Kolonisation Ostafrikas war, siedelten sich hier Perser, Inder, Araber, Engländer, Holländer und Deutsche als Herrschende und Geschäftsleute an. Der Großteil der Bevölkerung kommt ursprünglich aus Ostafrika. Dementsprechend vielfältig sind auch die Religionen und kulturellen Gemeinschaften in Stone Town. Neben dem islamischen Gros der Bevölkerung mit seinen Moscheen existieren Hindu-Tempel, katholische und protestantische Kirchen; außerdem leben hier buddhistische Gemeinschaften, Juden und Rastafari.
Omir sieht sich selbst nur halb als Rastafari an. Von seiner leiblichen Familie aus ist er sunnitischer Muslim. Wenn er sich als Muslim bezeichnet, dann bedeutet das für ihn heute Achtung seiner Kultur gegenüber, wohingegen Rastafarianismus seine Lebensphilosophie beinhaltet. Islam erscheint hier als Tradition, Rastafarianismus als Revolte gegen die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, wobei seine Furchtlocken analog zum Irokesenschnitt der Punks zu werten sind. Omir wußte nichts von Marcus Garvey. Rasta zu sein bedeutet für ihn “Peace, Love and Harmony.” Dazu paßt nicht, daß er sich seinen Lebensunterhalt teilweise durch Überfälle sichert. Das Gebot, keinen Alkohol zu trinken, nimmt er weder als Rasta noch als Muslim ernst. Er trägt Dreadlocks und redet andere Rastafari mit “brother” an. Er betrachtet sich als Teil der Rastafarifamilie von Sansibar. Alle Rastafari auf Sansibar kennen sich, alle helfen sich. Das erzählte Omir zumindest.
Omir ist bitterarm und hat nichts außer einer Matraze in einem fensterlosen Haus in der Altstadt von Stone Town, wo er mit seinem Freund Fejsal lebt, der nicht zu den Rastabrüdern gehört. Omir raucht selbst viel ganja, tut dies jedoch nicht in ritualisierter Form. Er ist bei den islamischen Händlern und Barbesitzern, wie auch seine Nicht-Rasta Freunde, sehr verschrien. Sie warnen mich davor, daß er mich ausrauben könnte.
Dies geschieht allerdings nur indirekt, da Omir mich durchgehend anschnorrt. Darin ist er auch sehr geschickt. Am zweiten Abend wird Omir in eine Schlägerei verwickelt, als er einem Muslim die Mütze vom Kopf reißt, um sie mir zu schenken. Als Gefühl der Verbundenheit, da er meint, ich würde mich wie ein Araber verhalten. Er erläutert das alles nicht näher. Ich verbringe in Stone Town drei Tage mit Omir.
Omirs Weltbild ist eher ein “irgendwie freundlich sein” als eine tiefergehende Identifikation mit der Rastafarireligion. Er lehnt die allgegenwärtige Zuhälterei in Stone Town ab und findet, daß Männer und Frauen gleichberechtigt miteinander umgehen sollten. Alles in allem erinnert er mich, nicht objektiv, sondern assoziativ, eher an einen Punkrocker als an einen tiefreligiösen Rastafari. Er lebt in Stone Town in einer Außenseiter- und Underdogstellung. Omir läßt seinen Bart nicht wachsen.

Hier ruht in Gott der Unterleutnant z. See Max Schelle - 24 Jahre alt fiel er am 19. März 1889 beim Sturm auf die befestigte Stellung bei Bogamoijo. Allen voran, der erste im feindlichen Lager -
Kurz darauf teilt er mir mit, daß er die Deutschen bewundere, weil sie Hitler gehabt hätten.
Weltenschöpfer Hitler: Der zweite Rastafari, den ich kennenlerne, lebt in einer banda, einer Hütte, am Strand von Nungwi im Norden von Sansibar. Er ist ungefähr Mitte 20, sehr schlank, trägt einen Vollbart und Dreadlocks bis zum Rücken, ansonsten nur eine weiße Shorts und bemüht sich, sich sehr sportlich zu bewegen. Selbstverständlich weiß er von Omir, da sie den gleichen Vater, Haile Selassie, haben und der gleichen Familie angehören. Seiner Meinung nach bedeutet Rastabruder zu sein, mit nichts zu leben, als dem, was die Erde gibt; natürlich und angeblich hat er auch kein Eigentum. (Das kann nicht ganz stimmen, da er den Großteil des Nachmittags in einer sehr teuren Strandbar verbringt). Von ihm erfahre ich, daß auf der Insel Sansibar besonders viele Rastafari leben, da hier das Zentrum des Sklavenhandels war und das Bewußtsein über “freedom” groß wäre. I
ch erwidere, daß dies auch daran liegen könne, daß Sansibar sowieso einen sehr offenen Charakter habe, in dem sich verschiedenste Religionen nebeneinander entwickeln. Als er mitbekommt, daß ich Deutscher bin, versichert er mir, daß sie, die Deutschen, seine Freunde wären, aber daß er die Italiener haßt und auch die Engländer, wegen des Überfalls auf Äthiopien und der Sklaverei. Dann erklärt er, daß die Rastafari “brothers in spirit with the jewish people” wären, da sie beide in der Diaspora lebten. Als ich ihn frage, ob er an Gott glaubt, sagt er mir, daß sie nicht an Gott, sondern an Haile Selassie, den king creator glauben würden, den Weltenschöpfer.
Kurz darauf teilt er mir mit, daß er die Deutschen bewundere, weil sie Hitler gehabt hätten. Ich erzähle vom Holocaust und vom Rassismus Schwarzen gegenüber. Er erklärt, daß sie dies alles wüssten, aber Hitler wäre der king creator gewesen, der Pharao. Hitler mußte es tun, seiner Meinung nach.
Danach fährt er fort, daß er mit allen Lebewesen im Einklang lebte, mit den Delphinen, mit den Fischen, mit den Vögeln in der Luft. Auffällig ist, im positiven Sinne, daß er mit seinen Freunden, die keine Rastafari sind, alles gemeinsam macht, hilfsbereit ist, freundlich, aufgeschlossen und sich tatsächlich frei bewegt.
Sansibar ist das Zentrum des Rastafarianismus in Ostafrika. Dies läßt sich damit erklären, daß hier die Erinnerung an den Sklavenhandel lebendig ist und die sozialen Strukturen ethnisch hierarchisiert sind wie in Jamaika. Kapitaleigner, Geschäftsleute stellen hauptsächlich Inder und Araber, wobei sich aus letzteren die Oberschicht zusammensetzt. Die Afrikaner stellen die Unterschicht. Seit der tansanischen Unabhängigkeit vermischten sich die sozialen Hierarchien.

Eine Seitenstraße in Kampala, der Hauptstadt von Uganda und eine der geschäftigsten Städte Afrikas.
Jamaika-Corner: Eine Seitenstraße in Kampala, der Hauptstadt von Uganda und eine der geschäftigsten Städte Afrikas. An einer Ecke sprechen mich zwei junge Männer, beide ca. 22 Jahre alt, an und fragen, ob ich ganja kaufen wolle. Beide tragen Jeansjacken, den typischen Kampalakurzhaarschnitt und Sandalen aus Gummi. Ich sage nein, da ich sie nicht kenne und kein Interesse an Scherereien mit der schlecht bezahlten örtlichen Polizei habe. Dann sehe ich über einem Laden das Schild “Jamaika-Corner”. Ich frage sie, ob sie Rastafari sind, was sie bejahen. Sie würden überhaupt nicht so aussehen, erwähne ich. Sie wären Rastafari im Kopf, geben die beiden zurück. Es wäre in Kampala zu gefährlich, öffentlich als Rastafari herumzulaufen. Als ich frage warum das so wäre, antworten sie, es hieße, die Rastafari würden die Kultur zerstören und die jungen Leute mit Drogen vergiften. Außerdem würden ihnen Prostitution und Zuhälterei vorgeworfen. Ich frage sie, ob das stimmt, was sie vehement verneinen. Zuletzt erwähnen sie noch, daß häufig Touristen hierher kommen und ganja kaufen.
Jamaika-Corner erinnert eher an einen halblegalen Headshop als an einen Treffpunkt für Angehörige der Rastafarireligion. Außer Jamaika und Marihuanakonsum deutet nichts auf Rastafarikultur hin.

Auch in seiner Kunst hält er sich an die Makondekultur (Tierskulpturen, Geister) statt an Rastafarisymbolik wie Löwen oder Äthiopien. Kunst ist in Ostafrika nie reine Abbildung von dinglicher Wirklichkeit ist, sondern Modell spiritueller Welten.
RasMwiri: Meine letzte Begegnung mit einem Rastafari in Ostafrika findet in Bagamoyo, der alten Hauptstadt von Deutsch-Ostafrika (nach dem ersten Weltkrieg, britisches Protektorat) statt. In Richtung Strand liegt der deutsche Soldatenfriedhof, auf dem ich photografiere als aus einem überdachten langgezogenen Holzbau, dem college of arts, ein junger Mann mit einer großen Wollmütze auf dem Kopf herauskommt. Er meint, ich solle mir doch die Skulpturen anschauen. Das würde auch kein Geld kosten. Es stellt sich heraus, daß er assistent teacher auf der Schule ist. Er ist aus Nordmozambique geflohen und stammt aus der Ethnie der Makonde, die für ihre Holzschnitzereien in ganz Ostafrika berühmt sind. Im Unterschied zum Rasta von Nungwi glaubt Mwiri an Gott. Viele seiner Sätze enden mit den Worten: “So god will.”
In den nächsten Tagen sehe ich ihm bei seinen Schnitzereien zu, in denen er vor allem Tiergeistsymbole aus der spirituellen Welt der Makonde darstellt, aber auch Totenköpfe. Außerdem modelliert Mwiri ähnliche Figuren aus Ton. Eine Schnitzerei aus Kokosholz stellt einen Elefantengeist da, mit Doppelgesicht, einem Schlangenschwanz (die Schlange ist bei den Makonde das Symbol der Heilung) und dem geschwollenen Bauch einer schwangeren Frau (der starke Elefant ist gleichzeitig Geist der Fruchtbarkeit). Mwiri bezeichnet sich selbst als Christ: ein Rastafari, der gleichzeitig Christ ist und in der spirituellen Welt der Makonde lebt.[6] Er tritt für die absolute Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein. Der Umgang in der Kunstschule ist denn auch ziemlich egalitär ist. Mwiri hat einen sehr engen Kontakt zu seiner leiblichen Familie und bezeichnet mich als Bruder, das heißt, er nimmt mich von Anfang an in seine Rastafamilie auf. In seiner Kunst thematisiert er verschiedenste natürliche und gesellschaftliche Begebenheiten;bei Darstellungen von Menschen steht meistens das Ujamaakonzept[7] im Mittelpunkt.
Seine religiösen Vorstellungen leitet Mwiri vor allem aus der Makondetradtion in Nordmozambique ab, wobei Rastafari zu sein sich auf eine weltliche Verortung bezieht. Dies wird nicht allzu deutlich, da er über diese Zusammenhänge ungerne spricht. Viele seiner Vorstellungen wie etwa die Tierverwandlung der Leopardenzauberer sind in Tansania verbreitet und stammen nicht aus dem karibischen Raum, sondern aus magischen Traditionen Ostafrikas. Auch in seiner Kunst hält er sich eher an Traditionen aus Tansania und Mozambique, vor allem der Makondekultur (Tierskulpturen, Geister) denn an Rastafarisymbolik wie Löwen oder Äthiopien. Das ist von Bedeutung, da Kunst in Ostafrika niemals nur reine Abbildung von dinglicher Wirklichkeit ist, sondern Handhabbarmachung spiritueller Welten.
Hier definiert sich Mwiri eindeutig nicht über Rastafarianismus, sondern über die Kultur, aus der er kommt (Makonde).[8] Er ist als Rastabruder auch nicht dogmatisch, was sich schon darin zeigt, daß er mich in seine family einbezieht, als er eine geistige Verbundenheit zwischen uns zu erkennen glaubt. Mwiri weiß über Garvey, sieht diesen aber nicht positiv. In Bagamoyo leben auch noch andere Rastafari, die keine Lockenträger sind. Mwiri kennt diese, ist aber nicht mit ihnen befreundet. Rastafari sind wegen ihres Marihuanakonsums in Bagamoyo nicht gerne gesehen.
Nachrede: Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen konnte ich insofern feststellen, daß für einige Rastafarianismus eher einen Lebensstil darstellt, der sich durch Marihuanarauchen und “außerhalb der Gesellschaft leben” kennzeichnet, während andere (wie Mwiri) eine religiöse Verbindung und Verankerung in der Rastafamilie haben. Es ist bezeichnend, daß besonders viele Rastafari in den Stationen des historischen Sklavenhandels leben (Bagamoyo und Sansibar). Gerade Sansibar hat eine große, verbindliche Rastafamilie, die in ganz Tansania bekannt ist und auf der gesamten Insel Netzwerke bildet. Fraglich ist, ob die Basis dieser family Sansibars Stellung im Sklavenhandel war oder ob nicht auch die Weltoffenheit des Handelsstützpunkts die Verbreitung karibischer Ideen auf der Insel begünstigte. Im Hinterland Tansanias findet man kaum Rastafari, in Uganda noch weniger. Auch wirken die Rastafari an der tansanischen Küste und auf Sansibar wesentlich “authentischer” als im Inland von Tansania und in Kampala. Die kampalischen Rastas scheinen eher Rastamänner nachzuahmen, als selbst welche zu sein. Dies resultiert aus der Anglisierung Ugandas während des britischen Kolonialismus.
In Uganda ist die “innere Kolonisation” noch heute offensichtlich. Viele Menschen in Uganda versuchen, sich in Kleidung und Verhalten als “schwarze Briten” zu zeigen. Möglicherweise begünstigt auch die ethnische und kulturelle Vielfalt und Eigenständigkeit der tansanischen Küstengebiete und Sansibars eine selbstständige Rastakultur. Die Rastabrüder von der Küste und aus Sansibar sind sehr in der Rastafaritradition verankert. Ähnliches gilt auch für die ostafrikanischen Rastas in ihrer sehr individuellen Weltsicht.
Anmerkungen
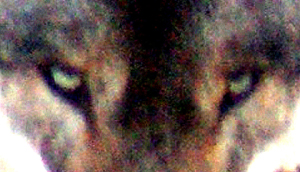 Der in einen Wolf oder ein anderes Tier verwandelte Mensch gehört zu den zentralen Mythen der Kulturgeschichte und zu einer der beliebtesten Figuren im modernen Horrormovie.
Der in einen Wolf oder ein anderes Tier verwandelte Mensch gehört zu den zentralen Mythen der Kulturgeschichte und zu einer der beliebtesten Figuren im modernen Horrormovie.  Die gängigen Merkmale eines Werwolfs sind durch den Horrorfilm geprägt. Der Werwolf in den Mythen der Menschheit unterschied sich aber massiv von der Bestie in Hollywood und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Die Einschränkung ist, dass Merkmale einer imaginierten Figur immer relativ sind: Auch die Vorstellungskraft der Menschen vergangener Kulturen war nahezu unbegrenzt; und wir werden unzählige Erzählvarianten finden, die vom gängigen Schema abweichen.
Die gängigen Merkmale eines Werwolfs sind durch den Horrorfilm geprägt. Der Werwolf in den Mythen der Menschheit unterschied sich aber massiv von der Bestie in Hollywood und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Die Einschränkung ist, dass Merkmale einer imaginierten Figur immer relativ sind: Auch die Vorstellungskraft der Menschen vergangener Kulturen war nahezu unbegrenzt; und wir werden unzählige Erzählvarianten finden, die vom gängigen Schema abweichen.  Die Darstellung der Verwandlung selbst ist zwar ein Paradies für Bühnenbildner und Computeranimation, hat aber mit den vormodernen Glaubenswelten wenig zu tun. Der Werwolf in den Hexenprozessen der frühen Neuzeit, auch der Leopardenmensch afrikanischer Kulturen oder die Hexe, die sich in eine Hyäne verwandelt, erscheinen entweder als Mensch oder als Tier. Allerdings finden sich in der volkskundlichen Literatur vereinzelt Hinweise auf körperliche Merkmale in der Menschengestalt, zum Beispiel zusammengewachsene Augenbrauen, ein verlängertes Rückgrat oder Haarwirbel. Auch außergewöhnliche Verhaltensweisen galten in Kulturen, die an solche Wesen glaubten, in deren Menschengestalt als Kennzeichen, ein besonderer Geruch, besondere Blicke, etc.. Gelegentlich lassen sich “Wertiere” auch daran erkennen, dass sie Schmuckstücke wie Ohrringe oder Ketten in Tiergestalt behalten. Der Pakt mit dem Teufel, die magische Kraft des religiösen Rituals waren die Wege, zu diesem Wesen zu werden - ein Werwolf war ein übernatürliches Wesen, ein dämonisches oder ein göttliches Wesen, aber kein im Sinne der modernen Biologie vorgestelltes.
Die Darstellung der Verwandlung selbst ist zwar ein Paradies für Bühnenbildner und Computeranimation, hat aber mit den vormodernen Glaubenswelten wenig zu tun. Der Werwolf in den Hexenprozessen der frühen Neuzeit, auch der Leopardenmensch afrikanischer Kulturen oder die Hexe, die sich in eine Hyäne verwandelt, erscheinen entweder als Mensch oder als Tier. Allerdings finden sich in der volkskundlichen Literatur vereinzelt Hinweise auf körperliche Merkmale in der Menschengestalt, zum Beispiel zusammengewachsene Augenbrauen, ein verlängertes Rückgrat oder Haarwirbel. Auch außergewöhnliche Verhaltensweisen galten in Kulturen, die an solche Wesen glaubten, in deren Menschengestalt als Kennzeichen, ein besonderer Geruch, besondere Blicke, etc.. Gelegentlich lassen sich “Wertiere” auch daran erkennen, dass sie Schmuckstücke wie Ohrringe oder Ketten in Tiergestalt behalten. Der Pakt mit dem Teufel, die magische Kraft des religiösen Rituals waren die Wege, zu diesem Wesen zu werden - ein Werwolf war ein übernatürliches Wesen, ein dämonisches oder ein göttliches Wesen, aber kein im Sinne der modernen Biologie vorgestelltes.  Erst die Naturwissenschaft der Moderne stellte sich die Frage nach dem Wie einer solchen Verwandlung statt der Frage “Was will Gott uns damit sagen?” Und die Zoologie ist eine Wissenschaft des 19. Jahrhunderts.
Erst die Naturwissenschaft der Moderne stellte sich die Frage nach dem Wie einer solchen Verwandlung statt der Frage “Was will Gott uns damit sagen?” Und die Zoologie ist eine Wissenschaft des 19. Jahrhunderts. 
 Der Grund liegt darin, dass die Menschen glaubten, dass sich in den Wendezeiten die Tore zwischen den Toten und Lebenden öffnen: Deshalb verkleiden sich amerikanische Kinder, Teenager, und auch Erwachsene am 31. Oktober, dem keltischen Samhain, in Werwölfe, Hexen, Vampire und andere Wesen der Nacht. Schwellenorte waren zum Beispiel Kreuzwege, Friedhöfe, insbesondere der Galgenberg. Die Zeiten, in denen Werwölfe sich in das Tier verwandelten, sind in den Mythen Europas allerdings unterschiedlich. Mal war es der Namenstag des Betroffenen, mal der Johannistag, mal die Zeit der Aussaat, in der livländische Bauern meinten, sich in Werwölfe zu verwandeln, um mit den Geistern der Toten um die Fruchtbarkeit der Felder zu kämpfen. Der Vollmond wurde erst durch die moderne Literatur und den Film zu einem Kernelement des Werwolfmythos.
Der Grund liegt darin, dass die Menschen glaubten, dass sich in den Wendezeiten die Tore zwischen den Toten und Lebenden öffnen: Deshalb verkleiden sich amerikanische Kinder, Teenager, und auch Erwachsene am 31. Oktober, dem keltischen Samhain, in Werwölfe, Hexen, Vampire und andere Wesen der Nacht. Schwellenorte waren zum Beispiel Kreuzwege, Friedhöfe, insbesondere der Galgenberg. Die Zeiten, in denen Werwölfe sich in das Tier verwandelten, sind in den Mythen Europas allerdings unterschiedlich. Mal war es der Namenstag des Betroffenen, mal der Johannistag, mal die Zeit der Aussaat, in der livländische Bauern meinten, sich in Werwölfe zu verwandeln, um mit den Geistern der Toten um die Fruchtbarkeit der Felder zu kämpfen. Der Vollmond wurde erst durch die moderne Literatur und den Film zu einem Kernelement des Werwolfmythos. 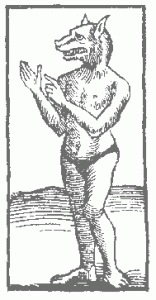 Den Werwolf überkommt sein Drang, zu morden wie den Serienkiller auch. Schon Theodor Lessing bezeichnete in den 1920er Jahren den Hannoveraner Jungenschlächter Fritz Haarmann als Werwolf von Hannover. Hier spielt die Vorstellung eine Rolle, dass die durch Zivilisation gebändigten Tierinstinkte des Menschen unter bestimmten Bedingungen außer Kontrolle geraten und die Verwandlung in ein Tier einhergeht mit einer Art pathologischem Rauschzustand.
Den Werwolf überkommt sein Drang, zu morden wie den Serienkiller auch. Schon Theodor Lessing bezeichnete in den 1920er Jahren den Hannoveraner Jungenschlächter Fritz Haarmann als Werwolf von Hannover. Hier spielt die Vorstellung eine Rolle, dass die durch Zivilisation gebändigten Tierinstinkte des Menschen unter bestimmten Bedingungen außer Kontrolle geraten und die Verwandlung in ein Tier einhergeht mit einer Art pathologischem Rauschzustand. Dafür gibt es aber keine Indizien. Jedoch gab es Mordserien, in denen die Täter glaubten, sich in Tiere zu verwandeln, so die Sekte der Löwenmenschen in Singida, Tansania, in den 1930er Jahren. Und es gibt tatsächlich sehr wenige Fälle von “pathologischer Lykanthropie”. Unter diesen sehr wenigen Menschen, die glauben, ein Wolf zu sein, sind wiederum sehr wenige, die in diesem Glauben Menschen ermordeten: “Romasanta - im Schatten des Werwolfs” von 2004 zeigt das Porträt eines solchen psychisch kranken Mörders und bezieht sich auf einen Prozess, der im 19. Jahrhundert in Spanien tatsächlich stattfand; der Film ist eher eine Dokumentation als ein Movie. Bei diesem Täter handelte es sich jedoch um einen modernen Menschen und nicht um ein Opfer der Hexenprozesse der frühen Neuzeit.